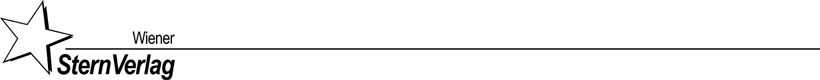
 | Abzeichen der österreichischen Arbeiterbewegung |
 | »Mein Kopf wird euch auch nicht retten« |
Über das Buch
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Zur Kommunikation der Häftlinge
Ausgewählte Briefe
Besprechungen
Buchpräsentation am 26. Oktober 2016
Personenregister
 | »Mich könnt ihr löschen, aber nicht das Feuer« |
 | Österreicher in der Roten Armee 1941 – 1945 |
 | Österreichische ÖkonomInnen der ArbeiterInnenbewegung |
 | Österreichische Remigration aus der Sowjetunion |
 | Bin ich ein guter Soldat und guter Genosse gewesen? |
 |
Bestellung / Kontakt |

»Mein Kopf wird euch auch nicht retten«.
Aus der Einleitung
BRIEFE – DIE NABELSCHNUR ZUR AUßENWELT
Wie sehr fehlende schriftliche Kommunikation die Häftlinge bedrückte, wird in jenen Passagen der Briefe des Augustiner Chorherrn Karl Roman Scholz sichtbar, die er an seinen Mitbruder schrieb: „Es sind ja acht Monate seit meiner Verhaftung. Und seither ist kein Wort und keine Zeile zu mir gedrungen. Ich warte und warte, dass endlich einmal ein richterliches Verhör und damit gewisse Hafterleichterungen, besonders Besuch und Post kommen. Zeit wäre es.“ Und im nächsten Brief bittet er seinen Mitbruder: „Vor allem, wenn es Ihnen nicht zu lästig fällt, schreiben Sie mir. Sie ahnen nicht, welche Freude ein paar Zeilen machen. Und mir schreibt ja, außer meiner Großmutter niemand, denn die Bekannten scheinen begreiflicherweise mit mir schwarzem Schaf nichts zu tun haben wollen. Ich kann ja auch niemandem zumuten, dass er meinetwegen Unannehmlichkeiten hat.“
Welchen Stellenwert Briefe für die Gefangenen hatten, kann auch einem Brief von Marie Fischer an ihre Tochter Erika entnommen werden, wenn sie ihr mitteilt:
„Soll ich dir schreiben, was wir empfinden, wenn wir von unseren Lieben Nachricht bekommen? Ich kann dies gar nicht schreiben, das muss selbst mitgemacht werden. Es ist Nachricht von der Außenwelt zu einem lebend Begrabenen, der noch eine kleine Hoffnung hat, doch noch einmal aus der Gruft zu kommen. Also bitte alle drei Wochen. Ich kann alle drei Wochen [einen Brief] von euch und einen Feldpostbrief empfangen.“
Bei Grete Jost klingt es ähnlich: „Die Tage, wo ich Post bekomme, Besuche habe oder selbst schreibe, sind immer die Tage der größten Ereignisse; nach diesen Tagen geht hier die Zeitrechnung.“
Die Briefe verblieben i.d.R. beim Häftling. Er hatte sie in der Schachtel, in der er auch seine wenigen Habseligkeiten aufbewahrte. Öfters wird in Briefen geschrieben, dass man immer wieder die Briefe der Angehörigen durchlesen würde. „Ich kann mir eure Briefe nicht mehr aufheben. Früher las ich sie sehr, sehr oft durch.“
In dieser Passage zeigt sich die Wichtigkeit von Briefen als Nabelschnur, die den Häftling mit seinen Angehörigen verband. Mit ihnen wurden die Umstände der Haft ein wenig gemildert und die psychische Verfasstheit der Gefangenen angehoben. Einerseits hatten die Häftlinge dadurch die Möglichkeit – wenn auch im engen Rahmen der Vorgaben – sich ’auszusprechen‘, andererseits konnten sie durch die Briefe wenigstens passiv am Leben der Familie teilhaben. Die Briefe trugen dazu bei, ihr Allgemeinbefinden positiv zu beeinflussen und gaben ihnen Halt, was sie auch den Angehörigen mitteilten.
„Herzlichen Dank für euren Geburtstagsbrief. Ich kann euch kaum meine Freude in Worten beschreiben, wenn ich von euch einen Brief bekomme. Von einem solchen Brief lebe ich immer wochenlang.“
Der Stellenwert der schriftlichen Kommunikation kann auch den Briefen von Max Zitter entnommen werden, der seit Oktober 1941 in Polizeihaft in Klagenfurt einsaß, selbst wöchent¬lich Briefe schreiben konnte, aber seiner Frau betrübt schrieb:
„Vielleicht hast einmal Gelegenheit. Warum schreibst du mir denn gar so wenig? Weißt du, in sechs Wochen nur einen einzigen Brief, einmal nur eine innere Zwie¬sprache mit dir, das ist wohl betrüblich in meiner Lage.“
Immer wieder vermitteln diese Korrespondenzen den Eindruck, dass der Inhaftierte damit die Tatsache seiner Haft – wenigstens für den Zeitraum des Briefeschreibens, bzw. des Lesens der an ihn gerichteten Briefe – ausblenden konnte. In einigen von ihnen kommt das Bemühen der Schreiber zum Ausdruck, aktiv am Familienleben teilzunehmen, vor allem, wenn es darum ging, den Angehörigen mitzuteilen welche Arbeiten zuhause, z.B. gerade im Garten, zu machen, oder welche anderen Dinge zu erledigen wären. In Bezug auf die Kindererziehung bedauerten die Frauen das Fehlen der ’väterlichen Autorität‘, was gerade bei pubertierenden Söhnen sichtbar wurde. Die diesbezüglichen Passagen bei Leopoldine Jelinek in den Briefen an ihren Mann zeigen das.