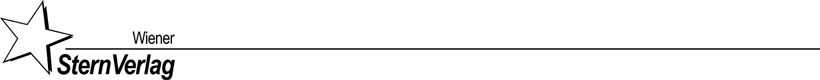
 | Abzeichen der österreichischen Arbeiterbewegung |
 | »Mein Kopf wird euch auch nicht retten« |
 | »Mich könnt ihr löschen, aber nicht das Feuer« |
 | Österreicher in der Roten Armee 1941 – 1945 |
 | Österreichische ÖkonomInnen der ArbeiterInnenbewegung |
Einleitung
Inhaltsverzeichnis
 | Österreichische Remigration aus der Sowjetunion |
 | Bin ich ein guter Soldat und guter Genosse gewesen? |
 |
Bestellung / Kontakt |

Österreichische ÖkonomInnen der ArbeiterInnenbewegung
Einleitung
Karl Marx und „Das Kapital“ – Anmerkungen zur Ausarbeitung der Werttheorie
Die Frage, die wir uns hier zu stellen haben, ist, was Marx mit den ersten zwei Kapiteln des „Kapital“ bezweckt. Man wird das besser verstehen, wenn man den Werdegang in der ökonomischen Theoriebildung von Marx und seine Ausarbeitung der Werttheorie betrachtet.
Als Marx sich 1844 in seinen Exzerptheften mit der Arbeitswerttheorie Ricardos befasste, so war er alles andere als ein Arbeitswerttheoretiker, in dem Sinne, wie wir das heute verstehen würden. Er näherte sich Ricardo von einem Standpunkt der ArbeiterInnenklasse und begann mit der völligen Negation auch der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie. Er versuchte dabei die Widersprüche in der Theorie der Klassiker aufzudecken und geriet in besagten Exzerptheften darauf, dass Ricardo einerseits die Arbeit als die Quelle aller Werte und die relative Arbeitsmenge als deren Maß proklamierte, wohingegen er gleich wie Smith die Produktionskosten (in die Lohn, Profit und Rente eingeschlossen seien) mit dem Wert identifizierte. Letztlich werden die Produktionskosten in der klassischen Ökonomie nicht durch die Produktion sondern durch die Konkurrenz bestimmt. Marx schloss aus dieser unzulänglichen Gleichsetzung von Wert und Kosten aber nicht schon auf einen Widerspruch von Wesen (Wert) und Erscheinung (Produktionspreis). Er meinte, wenn man die Konkurrenz berücksichtige, könne man überhaupt nicht davon ausgehen, dass der Arbeitsaufwand bestimmend für den Wert sei. Denn die Konkurrenz stelle erst den Wert (oder wie Marx es damals nannte, Handelswert, später Marktpreis) her. Marx ging also ursprünglich nicht davon aus, dass die Arbeit schon wertschaffend sei, sondern identifiziert den Wert mit dem Preis, oder eben, den sich durch die Konkurrenz herausbildenden Marktpreis mit dem Wert selbst.
Erst nach und nach gelangte Marx zu immer tieferen Einsichten und vermochte es auch, sich auf den positiven Gehalt der Klassiker der politischen Ökonomie zu stützen. Indem er nämlich zeigen konnte, dass die Klassiker nicht immer den Wert ignorieren, dass sie aber Wert und Wertgröße an entscheidenden Stellen identifizieren, weil sie den Wert nicht als eigene Qualität fassen können. Ricardos Widersprüche rühren daher, dass er die Substanz des Wertes nicht als der Arbeitsgrößenbestimmung „Vorgelagertes“ begreifen kann.
Forschungsweise und „Grundrisse“
Es ist nicht möglich und auch nicht zweckmäßig, hier den gesamten Werdegang der Marxschen Theorie nachzuzeichnen. Allerdings sei auf zwei entscheidende Vorarbeiten des Marxschen „Kapital“ verwiesen. Das sind einerseits die „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie“ (fertig gestellt im Mai 1858) und zum anderen die Arbeit „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ (fertig gestellt im Jänner 1859).
Wichtig ist zu bemerken, dass sich Marx in den „Grundrissen“ zum Wert theoretisch vortastet. Die Vorgehensweise in den „Grundrissen“ ist der Darstellungsweise im „Kapital” entgegengesetzt. Denn Marx beginnt nicht damit, die Ware zu analysieren, er beginnt mit einer Analyse des Geldes und arbeitet sich dann zur Ware vor. Er geht also vom Austauschprozess in seiner existierenden Gestalt aus, um zu untersuchen was es mit dem Geld auf sich hat. Das Geld vermittelt den Austausch. Aber Marx fragt dabei nach der Austauschfähigkeit der Waren und kommt zu dem Ergebnis, dass Waren, die sich qualitativ unterscheiden, im Austausch qualitativ gleichgesetzt werden. Sie besitzen in dieser qualitativen Gleichheit keinerlei Natureigenschaften. Denn wenn die Waren austauschbar sind, also in bestimmten quantitativen Relationen die Hände wechseln, so setzt dies voraus, dass sie Äquivalente sind. Aber Äquivalente können sie nicht als bestimmte, besondere Gebrauchsgegenstände sein. Diese Äquivalenz muss eine Äquivalenz außerhalb des Stofflichen sein. Er kommt schließlich zu dem Resultat, dass aufgrund dieses den Waren und dem Austauschprozess anhaftenden Widerspruches das Geld eben nur die Erscheinungsweise ist, in welcher sich der Austausch vollzieht. Die Ware verdoppelt sich, einmal als real zu tauschende Ware und einmal als ideeller Ausdruck, der anzeigt, in welcher Relation die Waren tauschen können, also wie sich die Warenquanta vor dem Austausch zueinander verhalten.
Welche Rolle spielt nun hierbei die Arbeit? Die Waren werden gleichgesetzt. Aber offensichtlich sind die Dinge die gleichgesetzt werden verschieden. Die Klassiker der politischen Ökonomie stießen darauf, dass es die Arbeit sein müsse, auf welche sich der Austausch bezieht. Aber Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Die Arbeit selbst müsse zunächst als bestimmte Qualität gefasst werden.
Zur „Wertsubstanz“ führt Marx bereits in den „Grundrissen“ aus, man müsse die Waren, welche einander gleichgesetzt werden, mit etwas Drittem gleich setzen, das nicht ihre eigene Qualität betrifft. Er schreibt: „Die Ware muss erst in Arbeitszeit, also etwas von ihr qualitativ Verschiedenes, umgesetzt werden (...), um dann als bestimmtes Quantum Arbeitszeit, bestimmte Arbeitsgröße, mit anderen Quantis Arbeitszeit, anderen Arbeitsgrößen verglichen zu werden.“ (MEW 42: 78)
Und zu den Gründen, weshalb dies so sei:
1. Arbeitszeit verstanden als diese Qualität sei nicht Arbeitszeit als Arbeitszeit, sondern (sozial) materialisierte Arbeitszeit, also etwas Ruhendes und nicht Bewegtes, es handle sich nicht um den Prozess, sondern um das Resultat.
2..Die Arbeit sei deshalb auch qualitativ verschieden von der Ware, weil die Arbeit in dieser qualitativen Bestimmtheit das Resultat einer bestimmten, natürlich bestimmten, von anderen Arbeiten qualitativ verschiedenen Arbeit ist.
Marx sagt: zum bloßen Vergleiche reicht es hin, die ideelle Wertbestimmung im Kopfe vorzunehmen, die Arbeiten also quantitativ gleichzusetzen. Aber beim Austausch müsse diese Abstraktion vergegenständlicht werden, symbolisiert werden durch ein Zeichen, welches den Austausch realisiert.
Der Wert sei also ideeller Ausdruck, der zunächst nur im Kopfe existiere. Um den wirklichen Prozess fassbar zu machen müsse man aber zu den stofflichen Trägern dieses ideellen Verhältnisses vordringen, eben zu den Waren.
Das allgemeine Äquivalent in „Zur Kritik“
In „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ beginnt Marx seine Analyse daher bereits mit der Ware, die er als Keimzelle der Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft fasst. Aber hier entwickelt Marx das Geld noch ganz aus den Schwierigkeiten des Austauschprozesses. Das Geld erscheint als die Lösungsbewegung eines Widerspruches, dass nämlich die Waren, um tauschen zu können, obgleich ihrer qualitativen Verschiedenheit als Gebrauchsgegenstände, qualitativ gleich zu setzen sind. Im Geld sei der Widerspruch, der allen Waren innewohnt, gelöst, da das Geld, als besondere Ware, als Produkt besonderer, konkreter Arbeit, zugleich allgemeine Ware sei, also in ihrer Eigenschaft als besondere Ware zugleich von allen gebraucht wird, allgemeine Arbeit vorstellt. Das heißt als Gebrauchswert Wert ist. Sodass alle anderen Waren, um zu tauschen, sich erst im Geld ideell spiegeln. Und ihre Relationen, zu welchen sie sich tauschen können, bekannt sind, ehe der wirkliche Austauschprozess stattfindet. Das Resultat ist also ideell vorweggenommen.
Marx bemerkt jedoch in einem Brief an Engels, dass in „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ das Geld zu schnell da sei. Er schreibt: „Die Schwierigkeit der Entwicklung habe ich in der ersten Darstellung (Duncker) dadurch vermieden, dass ich die eigentliche Analyse des Wertausdrucks erst gebe, sobald er entwickelt, als Geldausdruck, erscheint.“ (MEW 31: 306)
Marx kommt also zu dem Ergebnis, dass die Entwicklung der Geldform selbst zu präzisieren ist durch eine Darstellungsweise, welche aufdeckt, wie schon im einfachsten Wertausdruck die Geldform schlummert.
Marx entwickelt das Geld also ursprünglich nicht logisch anhand der Wertformanalyse, sondern aus der tatsächlichen Praxis des Austauschprozesses, der ein historisches Produkt ist. Was die allgemeine Äquivalentform als Geld auszeichnet, ist, dass die allgemeine Äquivalentform sozial verfestigt ist und nicht mehr jeder beliebigen Ware zukommen kann. Wäre dem nicht so, also könnte jede beliebige Ware diese Form annehmen, so schließe dies die allgemeine Äquivalentform aus, da sich ja verschiedene Waren den Platz um die allgemeine Äquivalentform streitig machen würden, was nur bedeutet, dass es eben kein allgemeines Äquivalent geben könnte.
Darstellungsweise und „Das Kapital“
Was wichtig ist, hier festzuhalten: In der Marxschen Wertformanalyse des ersten Bandes des „Kapital“ betrachtet Marx nicht schon den realen Austauschprozess, sondern nur die ideellen Formen, worin sich die Waren, relative Wertform und Äquivalentform bespiegeln. Aus der logischen Analyse der Wertformen folgt daher auch keineswegs die real-praktische Notwendigkeit des Geldes, die eine historische Tat ist. Den Austauschprozess und damit das Geld kann Marx in der Darstellung des „Kapital“ eigentlich erst mittels des zweiten Abschnitts, welcher den real-praktischen Austausch einführt, begründen. Das Geld, wie es in der vierten und letzten Wertform im „Kapital“ entwickelt wird ist daher eigentlich nicht logisch herzuleiten und zu begründen. Aber der Ausgangspunkt von Marx hinsichtlich seiner Forschung ist ein anderer. Er hat das Geld als praktische Lösungsbewegung eines Widerspruchs gefasst und konnte so der Entwicklung des Geldes von der einfachen Wertform an nachgehen.
Es ist daher ein Missverständnis, wenn angenommen wird, dass Marx im ersten Kapitel des „Kapitals“ einer historischen Entwicklung des Kapitalismus folgen würde. Gleichwohl nimmt Marx einen historischen Standpunkt ein, ehe er logisch zurückgehen kann zu den ursprünglichen Formen, worin sich die Waren bespiegeln. Aber Marx sagt, dass die Entwicklung der Warenform mit der Entwicklung der Wertform historisch zusammenfällt. Dies ist aber eben so zu verstehen, dass erst der Kapitalismus die entwickeltste Form der warenproduzierenden Gesellschaft ist. Sodass das Geld als alles vermittelndes Prinzip und Ausdruck des allseitigen Marktzusammenhangs eben die adäquate Erscheinungsform des Wertes ist, also eines gesellschaftlichen Verhältnisses in welchem die Menschen ihre Arbeiten als gesellschaftliche aufeinander beziehen. Nicht weil ihnen ihre Arbeitsprodukte als gleich gelten, sondern indem sie diese im Austausch als Werte aufeinander beziehen setzen sie ihre Arbeiten einander gleich. Sie wissen das nicht, aber sie tun es.